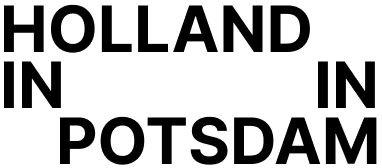Von verschwundenen Türen und Schnorch
Sanierung im Holländischen Viertel
Als junges Pärchen in den Zwanzigern und berauscht von der politischen Wende strebten wir ab Ende 1989 von Berlin-Wilmersdorf gefühlt jedes Wochenende in das geheimnisvolle Land „DDR“, das uns so fremd war und uns doch unmittelbar umgab. Wir staunten über das Nebeneinander von unberührter Natur und Industriebrachen, über Herrenhäuser und Schlösser in ihrer verfallenden Schönheit und teilweise brutale bauliche Eingriffe. Wir lernten, das geordnete Schlangestehen in Geschäften (Ost) dem ungeordneten Drängeln an der Fleisch- und Käsetheke (West) vorzuziehen, begegneten Menschen, die „mehr Sein als Scheinen“ verinnerlicht hatten und sich für nichts und niemand verbogen, und anderen, die sich ganz schnell auf die „neue Zeit“ umstellten. Und wir lernten auch uns bis dato unbekannte Ausdrücke kennen, zum Beispiel: Schnorch.
Schnorch?!
Man nehme ein unsaniertes Haus, das seit mehreren Jahrzehnten leer steht, bei dem das Dach undicht ist, weshalb die Dielung schadhaft wird, die Lehm- und Strohstakung lose von der Decke herunterhängt, die Balken von Schimmel überzogen sind, die Abwasserrohre eingetrocknet sind und die noch vorhandenen Möbel von Staub und Dreck überzogen sind. Dann öffne man an einem Frühsommertag, wenn es draußen schon warm ist, vorsichtig die Tür eines solchen Hauses, trete in den wegen der geschlossenen Fensterläden dunklen Flur und sauge die kühle, nein, kalte Luft ein, die einem entgegenschlägt. Das ist Schnorch – so zumindest haben wir es von unseren Nachbarn gelernt, und die mussten es ja wissen. Unsere Nachbarn, das waren die Pioniere, die bereits kurz vor der Wende ein Haus, meist kaum mehr als eine Ruine, im Holländerviertel erworben hatten und dies auch nur deshalb konnten, weil sie der Spezies der Bau-Affinen angehörten, also Architekten, Hoch- oder Tiefbauingenieure waren oder ansonsten als geeignet erschienen, das Abenteuer der Sanierung dieser Häuser zu bestehen. Zu diesen gesellten wir uns 1990 hinzu, auch wenn wir von Bauen ungefähr so viel Ahnung hatten wie ein Fisch vom Radfahren. Aber die spontane Schockverliebtheit in dieses Viertel, die uns ereilte, als wir im Februar 1990 zum ersten Mal durch die Mittelstraße gingen wie der Prinz, der es endlich bis zum schlafenden Dornröschen geschafft hat, ließ uns nicht los. Daher suchten wir fast unmittelbar nach Rückkehr von diesem folgenschweren Ausflug per Zeitungsannonce in den damaligen Brandenburgischen Neuesten Nachrichten schlicht nach einem „Haus im Holländerviertel“. Erstaunlicherweise meldeten sich etliche Anbieter; mit einem Ehepaar in unserem Alter, dessen Grundstück das kleinste überhaupt war (187 qm), wurde es dann ernst – und so wurden wir im Viertel vermutlich die ersten West-Eigentümer, die tatsächlich kauften und nicht geerbtes Eigentum oder per Restitution alten Familienbesitz zurückbekamen.



Zurück zum Schnorch – ja, so roch auch unser Haus, kein Wunder, denn es hatte einige Zeit leer gestanden und konnte mit allem aufwarten, was eine Sanierung so mühselig macht: undichte Dachkehlen, infolgedessen Schwamm, Schimmel, Moder, weggefaulte Balkenköpfe, so dass nur noch die aufliegende Dielung dafür sorgte, dass nicht gleich die ganze Zimmerdecke gen Süden sauste, außerdem Holzbockbefall, versottete Schornsteine, durch die die gesamte Mittelwand des Hauses mit Teer vollgesogen war, Fenster und Türen, die teilweise barock, teilweise jünger waren, denen aber sämtlichst die Fenstergriffe oder Türklinken fehlten, weil die von Altmetall-Dieben herausgebrochen waren, um sie zu einem Spottpreis an Aufkäufer zu verhökern – und diese Liste ließe sich noch ewig fortsetzen. Hinzu kam, dass Handwerker Anfang der neunziger Jahre auch nicht leicht zu bekommen waren: das ganze Land brauchte sie ja. Auch gab es noch keinen Mobilfunk, um sich zu verständigen, einen Festnetzanschluss hatten ebenfalls nur die wenigsten, so dass Absprachen entweder direkt mündlich oder per Brief getroffen werden mussten – und bis zum nächsten Baustellenbesuch konnte man nur hoffen, dass irgendetwas passiert war. So ähnlich lief auch die Abstimmung mit den im Aufbau befindlichen Behörden: niemand wusste wirklich, welche Regeln gerade galten, das machte es einerseits schwierig, andererseits bot es Möglichkeiten zum kreativen Umgang mit dem Recht und zur unkonventionellen Erledigung von Angelegenheiten, die sich heute wohl ewig hinziehen würden. Ein Beispiel: im Erdgeschoss unseres Hauses befand sich ein Türrahmen, der in seinem oberen Teil durch einen Rundbogen, man sagt wohl auch Korbbogen dazu, abgeschlossen wurde – die dazugehörige Tür gab es nicht, zumindest befand sie sich nicht im Haus. Dann aber erfuhren wir, dass jemand angeblich diese für das Holländische Viertel ungewöhnliche Tür im Lager der Denkmalpflege im ehemaligen Stasigefängnis in der Lindenstraße gesehen habe, sie sei mit einem auf das Türblatt gepinseltem „M“ wie „Mittelstraße“ und unserer Hausnummer markiert gewesen. Also fuhren wir gleich dorthin, erklärten, wir hätten gerne unsere Tür zurück – und tatsächlich ging ein Mitarbeiter der Denkmalpflege mit uns durch den Zellentrakt, in dem vor kurzem noch Gefangene unter unsäglichen Bedingungen einsitzen mussten, öffnete eine Tür, hinter der sich allerlei geborgene Gegenstände aus dem Viertel befanden – und dort entdeckten wir dann auch gleich die Tür, die heute zu unserem Wohnzimmer führt. Sie wurde uns nach heutiger Erinnerung ohne irgendeine Prüfung unserer Personalien, Eigentümerstellung o.ä. ausgehändigt, wir packten sie ins Auto, begeistert, ein weiteres Puzzleteil auf dem Weg zur Wiederherstellung des Hauses erhalten zu haben.
Nach mehr als dreißig Jahren finden wir es immer wieder erstaunlich, dass beim Vorbeigehen an einem sanierungsbedürftigen Haus, von dem eine kleine Prise Schnorch herüberweht, sofort ein ganzer Strauß von Gefühlen/Eindrücken/Anekdoten aufblüht, während ansonsten die Erinnerungen an diese Zeit eher passiv abgelegt sind. Aber so funktioniert das olfaktorische Gedächtnis offenbar immer.
– Renate Hellenthal
Titelbild: Giebel im Holländischen Viertel, Potsdam │ Foto: Wikimedia Commons, Axel Hindemith